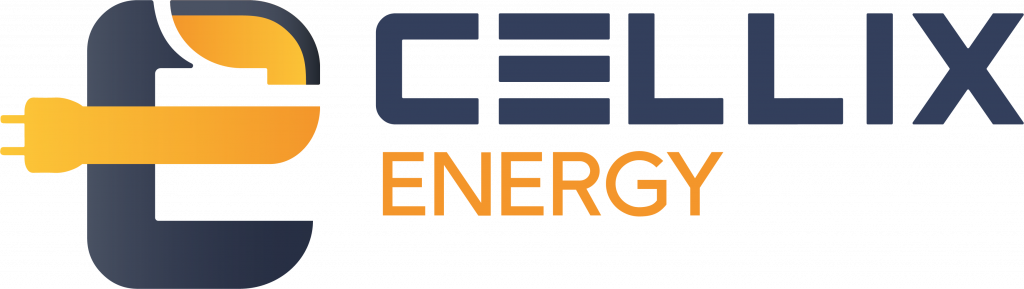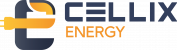FAQs
Immer auf dem neuesten Wissensstand bleiben mit unseren Blogs von Cellix Energy:
Ist dein Eigenverbrauch steuerpflichtig?
Auf Einnahmen (Einspeisung bzw. Verkauf) und Entnahmen (Selbstverbrauch) aus dem Betrieb einer PV-Anlage muss keine Einkommensteuer mehr gezahlt werden – und zwar rückwirkend ab 1.1.2022. Dabei ist unerheblich, wofür der erzeugte Strom verwendet wird
Ab sofort sind Einkünfte und Entnahmen beim Betreiben von Photovoltaik-Anlagen bis 30 kWp Leistung auf Einfamilienhäusern und anderen Gebäuden von der Einkommensteuer befreit. Bei Mehrfamilienhäusern gilt eine Grenze von 15 kWp je Wohn- und Gewerbeeinheit.
- Die Regelung gilt für alle Steuerpersonen, auch für bestehende Anlagen, sofern die Kriterien erfüllt sind.
- Eine Begrenzung von insgesamt 100 kWp pro Steuerperson ist festgelegt.
- Allerdings können Abschreibungen und Kosten nicht mehr geltend gemacht werden.
- Rückwirkend gilt die Regelung schon für das Steuerjahr 2022, somit auch für die Steuererklärung für dieses Jahr.
- Anders als bei der bisherigen Liebhabereiregelung gibt es keine Änderung der Steuerbescheide für die Steuerjahre bis 2021.
- Außerdem entfällt künftig die Liebhabereiregelung nach BMF-Schreiben.
• Die Änderungen sind in der neuen Nummer 72 in § 3 des Einkommensteuergesetzes (EStG) verankert.
Wie viel KW sind steuerfrei?
Die Einnahmen aus Anlagen mit einer Maximalleistung von bis zu 30 Kilowatt-Peak (kWp) sind nun steuerfrei – und das rückwirkend ab dem Jahr 2022. Dies gilt sowohl für Photovoltaikanlagen auf dem eigenen Einfamilienhaus als auch auf Gebäuden, die nicht Wohnzwecken dienen, beispielsweise Gewerbeimmobilien.
Photovoltaikanlagen sind eine immer beliebter werdende Möglichkeit, um erneuerbare Energien zu nutzen und gleichzeitig Stromkosten zu sparen. Seit dem 1. Januar 2023 gibt es noch einen weiteren Vorteil, der Interessenten dazu animieren sollte, in solche Anlagen zu investieren. Denn seit diesem Jahr sind die Einnahmen aus Anlagen mit einer Maximalleistung von bis zu 30 Kilowatt-Peak (kWp) steuerfrei.
Was bedeutet dies genau? Zunächst einmal ist es wichtig zu wissen, was Kilowatt-Peak eigentlich bedeutet. Hierbei handelt es sich um die maximal mögliche Leistung einer PV-Anlage unter standardisierten Bedingungen, also beispielsweise unter optimalen Sonneneinstrahlungsverhältnissen. Die maximale Leistung wird in Kilowatt-Peak gemessen.
Für den Endverbraucher bedeutet das nun, dass Einnahmen aus Photovoltaikanlagen mit einer Maximalleistung von bis zu 30 kWp nun steuerfrei sind. Die Regelung gilt sowohl für Anlagen auf dem eigenen Einfamilienhaus als auch auf Gebäuden, die nicht Wohnzwecken dienen, wie beispielsweise Gewerbeimmobilien. Dabei ist wichtig zu betonen, dass diese Regelung rückwirkend ab dem Jahr 2022 gilt.
Die neue Regelung ist ein wichtiger Schritt hin zu einer energieeffizienteren und nachhaltigeren Zukunft. Denn durch die Steuerbefreiung können mehr Menschen dazu animiert werden, in den umweltfreundlichen Strom zu investieren. Zudem ist es ein positives Signal an diejenigen, die bereits in erneuerbare Energien investiert haben und nun von einer weiteren Entlastung profitieren können.
Insgesamt ist die neue Regelung ein wichtiger Schritt, um den Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland voranzutreiben. Indem die Steuerpflicht für Einnahmen aus Photovoltaikanlagen bis zu einer Maximalleistung von 30 kWp entfällt, wird es für viele Menschen attraktiver, in solche Anlagen zu investieren. Diese Regelung liefert somit einen weiteren Anreiz für den Ausbau erneuerbarer Energien und für eine umweltfreundliche Zukunft.
Wie hoch ist die Einspeisevergütung 2025?
Die Einspeisevergütung für neu installierte Photovoltaikanlagen in Deutschland (Inbetriebnahme zwischen 1. Februar und 31. Juli 2025) richtet sich nach dem EEG und ist gestaffelt nach Anlagenleistung:
Bis 10 kWp:
– Teilweiseinspeisung (Eigenverbrauch + Einspeisung): 7,94 ct/kWh
– Volleinspeisung: 12,60 ct/kWh
Zwischen 10 kWp und 40 kWp:
– Teileinspeisung: 6,88 ct/kWh
– Volleinspeisung: 10,56 ct/kWh
Diese Sätze gelten aktuell bis Ende Juli 2025. Danach reduzieren sich die Vergütungen leicht. Konkret heißt das, dass die Vergütungssätze für einen bestimmten Zeitraum stabil bleiben (aktuell z. B. Februar bis Juli 2025).
Danach (ab August 2025) werden die Sätze monatlich oder quartalsweise um einen kleinen Prozentsatz – meist 0,4 % bis 1 % – abgesenkt. Das soll den Ausbau weiterhin fördern, aber Überförderung vermeiden.
Beispiel:
Wenn die Vergütung bis Juli 2025 bei 7,94 Cent/kWh liegt und sie ab August um 1 % sinkt, beträgt sie dann 7,86 Cent/kWh.
Was ändert sich 2025 bei Photovoltaik?
In Deutschland traten ab März 2025 mehrere wichtige Änderungen für neue PV-Anlagen in Kraft:
- Das Gesetz trat am 25.02.2025 in Kraft. Die Regelungen gelten für alle Anlagen, die ab diesem Datum in Betrieb genommen werden.
- Keine Einspeisevergütung bei negativen Strompreisen: Betreiber neuer PV-Anlagen erhalten während negativer Börsenpreise keine Vergütung mehr. 2024 gab es 457 solcher Stunden, wovon ein Großteil mit PV-Erzeugungsstunden zusammenfiel.
- Einspeisebegrenzung auf 60 Prozent für neue Anlagen ohne Steuerbox: Solaranlagen, die ab dem 25.02.25 ans Netz gehen, dürfen vorerst nur 60 Prozent ihrer Nennleistung einspeisen, bis eine Steuerbox installiert ist.
- Eigenverbrauch & intelligente Vernetzung werden wichtiger: Wer seinen Solarstrom gezielt selbst nutzt, speichert oder flexibel einspeist, profitiert künftig am meisten.
- Durchschnittlich 21 Prozent weniger Einnahmen für ungesteuerte Neuanlagen: Wir rechnen anhand von echten Kundendaten vor, wie sehr sich die Neuregelungen auf verschiedene Systeme auswirken.
Was ist bei einer PV-Anlage größer 30 kWp zu beachten?
Geht der Eigenverbrauch über die 30 Megawattstunden hinaus oder sind mehr als 30 Kilowatt Leistung installiert, werden wie gehabt 40 Prozent der EEG-Umlage auf den gesamten Eigenverbrauch fällig. Die Ausweitung der Bagatellgrenze gilt dabei sowohl für Neuanlagen als auch für Bestandsanlagen (§ 100 Abs. 2 Nr. 14a).
eeg Umlage Wegfall für 2023
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/klimaschutz/novelle-eeg-gesetz-2023-2023972
Sind Photovoltaikanlagen 2025 von der Umsatzsteuer befreit?
Ja, auch im Jahr 2025 sind Photovoltaikanlagen unter bestimmten Voraussetzungen weiterhin von der Umsatzsteuer befreit. Grundlage dafür ist der sogenannte Nullsteuersatz (§ 12 Abs. 3 UStG), der seit dem 1. Januar 2023 gilt. Dabei entfällt die Mehrwertsteuer (regulär 19 %) auf Kauf, Lieferung und Installation von Photovoltaikanlagen und Batteriespeichern.
Voraussetzung für die Steuerbefreiung ist, dass die Anlage auf oder in der Nähe eines Wohngebäudes, eines öffentlichen Gebäudes oder eines Gebäudes mit gemeinnütziger Nutzung installiert wird. Zudem darf die Leistung der einzelnen Anlage 30 Kilowatt peak (kWp) nicht überschreiten. Auch Erweiterungen bestehender Anlagen sind begünstigt, wenn sie die Voraussetzungen erfüllen.
In der Praxis bedeutet das: Der im Angebot ausgewiesene Preis ist ein Bruttopreis ohne Mehrwertsteuer – also identisch mit dem Nettopreis. Betreiber kleinerer PV-Anlagen profitieren damit von einer spürbaren Kostenersparnis und einer einfacheren Abwicklung.
Für größere Anlagen oder gewerbliche Nutzungen (z. B. über 30 kWp, auf Gewerbebauten oder mit Leasingverträgen) gilt der Nullsteuersatz nicht automatisch. In diesen Fällen kommt in der Regel wieder der normale Umsatzsteuersatz von 19 % zum Tragen.
Zusammenfassung der Vorteile 2025
Förderbereich | Bezugsgröße |
EEG-Einspeisevergütung | ca. 6–12 ct/kWh je nach Anlagenleistung |
KfW-Kredit 270 | Bis 100 % Finanzierung, ~3,7 % Zins |
Umsatzsteuer | 0 % bis 30 kWp |
Einkommen- & Gewerbesteuer | Einheitlich befreit bei ≤ 30 kWp |
Regionale Zuschüsse | Speicher, Balkonkraftwerke etc. |
BEG-Förderung | Kombis PV/Speicher im effizienten Hausbau |
Welche Förderungen, Zuschüsse oder steuerliche Vorteile gibt es aktuell für PV-Anlagen?
Gibt es aktuell Förderprogramme für Photovoltaikanlagen?
Ja. In Deutschland gibt es mehrere Fördermöglichkeiten auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene. Die wichtigsten Förderprogramme sind:
- KfW-Förderung: Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) bietet zinsgünstige Kredite, z. B. über das Programm 270 „Erneuerbare Energien – Standard“.
- Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG): Kombiniert man eine PV-Anlage mit einer Wärmepumpe oder einem Batteriespeicher, kann es zusätzliche Förderung über die BEG geben.
- Landesprogramme: Je nach Bundesland gibt es zusätzliche Förderungen, z. B. für Stromspeicher oder Balkonmodule.
Kommunale Zuschüsse: Manche Städte und Gemeinden bezuschussen kleine PV-Anlagen, Speicher oder
Was kostet eine PV Anlage für ein Einfamilienhaus?
Der Preis einer Photovoltaikanlage für ein Einfamilienhaus kann je nach Größe und Hersteller sehr unterschiedlich sein. Grundsätzlich sind aber die Kosten in der Regel hoch. In der Kleinform beginnen diese bei rund 2.000 €, wobei größere Anlagen oftmals bis zu 20.000 € und mehr kosten können.
Bei der Berechnung des Endpreises sollten immer auch Faktoren wie Montagekosten, Wartungskosten und Garantiebedingungen berücksichtigt werden. Zudem bietet manche Hersteller noch spezielle Finanzierungsmöglichkeiten an, um die Errichtung einer Photovoltaikanlage attraktiver zu machen.
Abschließend ist es wichtig zu betonen, dass sich die Investition in eine photovoltaische Anlage langfristig lohnt – sowohl finanziell als auch ökologisch betrachtet. Es lohnt sich deshalb genau zu berechnen, ob sich der Eigenverbrauch über die Jahre amortisiert und ob weitere Investitionsmöglichkeiten vorhanden sind, um den Return on Investment zu maximieren.
Was kostet eine Solaranlage mit Speicher für ein Einfamilienhaus?
Wenn man sich für die Errichtung einer Photovoltaik-Anlage mit Speicher für sein Einfamilienhaus entscheidet, sollte man sich im Klaren darüber sein, dass diese Investition nicht günstig ist. Der Preis einer Solaranlage mit Speicher kann je nach Größe und Hersteller stark variieren, aber in der Regel liegt er deutlich höher als bei reinen Photovoltaik-Anlagen ohne Speichermöglichkeit.
Abhängig von der Größe der Anlage und den speziellen Anforderungen an den Speicherbelagern kann man schon mit rund 5.000 € rechnen. Bei größeren Anlagen können die Kosten aber auch bis auf 20.000 € oder mehr steigen.
Neben dem Kaufpreis muss zudem auch auf mögliche Zusatzkosten wie Montagekosten und Garantiebedingungen geachtet werden. Auch hier bietet manche Hersteller spezielle Finanzierungsmöglichkeiten an, um den Return on Investment zu optimieren. Am Ende lohnt sich die Investition aber in jedem Fall – finanziell und ökologisch betrachtet.
Wann ist eine PV-Anlage wirtschaftlich?
Wann rechnet sich eine Photovoltaikanlage? Eine PV–Anlage rechnet sich in dem Moment, da sie mehr Geld eingespart hat, als für ihren Betrieb ausgegeben wurden. Man spricht von der Amortisationszeit. Für Standard-Dachanlagen liegt die Amortisationszeit bei etwa 10 Jahren.
Immer mehr Menschen in Deutschland überlegen sich, ob sich die Investition in eine Photovoltaikanlage lohnt. Doch wann rechnet sich eine solche Anlage überhaupt?
Die Antwort ist einfach: Eine PV-Anlage rentiert sich in dem Moment, wenn die Einsparungen höher sind, als für ihren Betrieb ausgegeben wurde. Dieser Zeitpunkt wird Amortisationszeit genannt.
Auch wenn es keine allgemeingültige Aussage gibt und die Amortisationszeit von vielen Faktoren abhängig ist – so liegt die typische Amortisationszeit bei Standard-Dachanlagen für den privaten Haushalt im Schnitt bei etwa 10 Jahren. Allerdings können Kostensparpotenziale erheblich steigen, je nach Standort der Anlage und den anfallenden Investitionskosten.
Fakt ist jedoch auch hier: Eine Photovoltaikanlage benötigt zunächst Kapital – und das sollte man berücksichtigen, bevor man sich über Investitionen Gedanken macht. Aber sobald das Geld investiert worden ist lassen sich mit Solarstrom langfristig viele Ersparnisse machen und damit letztlich der Kapitalbedarf rechtfertigen.
Werden PV Anlagen 2025 billiger?
Im Jahr 2025 sind Photovoltaikanlagen insgesamt deutlich günstiger geworden als in den Vorjahren. Sowohl die Preise für Solarmodule als auch für Batteriespeicher und Wechselrichter sind spürbar gefallen. Grund dafür sind vor allem sinkende Herstellungskosten, ein hohes Angebot auf dem Weltmarkt – insbesondere durch die starke Produktion in Asien – sowie technologische Fortschritte, die die Produktion effizienter und kostengünstiger machen. Auch Lagerüberhänge bei Herstellern und Händlern führen aktuell zu Preissenkungen.
Für Endkunden bedeutet das: Die Investitionskosten für eine neue PV-Anlage sind heute niedriger als noch vor ein bis zwei Jahren. Dadurch verkürzt sich in vielen Fällen auch die Amortisationszeit. In Kombination mit steuerlichen Vorteilen und Fördermöglichkeiten bleibt die Anschaffung einer Photovoltaikanlage wirtschaftlich attraktiv.
Wie berechne ich die Amortisationszeit meiner PV-Anlage?
**1. Was bedeutet „Amortisationszeit“ überhaupt?
**
Die Amortisationszeit gibt an, wie lange es dauert, bis sich die Investition in eine PV-Anlage durch Einsparungen bei den Stromkosten und Einnahmen (z. B. durch Einspeisung) refinanziert hat. Ab diesem Zeitpunkt arbeitet die Anlage rechnerisch „kostenlos“ bzw. erwirtschaftet Gewinn.
2. Welche Faktoren beeinflussen die Amortisationszeit?
Folgende Punkte spielen eine zentrale Rolle:
- Anschaffungskosten (inkl. Installation, Speicher, ggf. Wartung)
- Förderungen und Steuererleichterungen
- Eigenverbrauchsquote: Je mehr Strom du selbst nutzt, desto schneller amortisiert sich die Anlage.
- Einspeisevergütung: Einnahmen durch Einspeisung ins öffentliche Netz
- Strompreis: Je höher der Strompreis, desto größer die Einsparung
- Leistung der Anlage (kWp) und geografische Lage (Sonnenertrag)
3. Wie berechne ich die Amortisationszeit in der Praxis?
Formel (vereinfacht):
👉 Amortisationszeit = Investitionskosten / jährlicher finanzieller Nutzen
Beispielrechnung:
- Investition: 15.000 €
- Jährliche Einsparung (Eigenverbrauch): 700 €
- Einnahmen aus Einspeisung: 300 €
➡️ Gesamtersparnis pro Jahr: 1.000 €
👉 15.000 € ÷ 1.000 € = 15 Jahre Amortisationszeit
Mit Speicher oder höheren Eigenverbrauchsquoten kann sich die Amortisationszeit deutlich verkürzen.
4. Wie kann ich den Eigenverbrauch optimieren, um schneller zu amortisieren?
- Stromnutzung in die Tagesstunden verlegen (z. B. Waschmaschine, Spülmaschine)
- Nutzung eines Batteriespeichers, um Strom auch abends zu verbrauchen
- Einsatz von Wärmepumpen, E-Autos oder Heizstäben
- Smarte Energiemanagementsysteme
5. Gibt es Tools zur Berechnung?
Ja, es gibt kostenlose Online-Rechner, mit denen du anhand deiner individuellen Daten (Dachfläche, Verbrauch, Speicher etc.) die Amortisation berechnen kannst. Auch viele Solarteure bieten diese Berechnung im Beratungsgespräch an.
Fazit:
Die Amortisationszeit ist individuell und hängt von vielen Faktoren ab. In Deutschland liegt sie typischerweise zwischen 8 und 15 Jahren – bei steigenden Strompreisen tendenziell kürzer.
Lohnt sich eine PV-Anlage für mich?
1. Für wen lohnt sich eine PV-Anlage grundsätzlich?
Eine Photovoltaikanlage lohnt sich für fast alle Eigenheimbesitzer, vor allem wenn:
- eine geeignete Dachfläche vorhanden ist (idealerweise Süd-, Ost- oder Westausrichtung),
- ein jährlicher Stromverbrauch von mindestens 2.500 kWh besteht,
- Interesse besteht, langfristig Energiekosten zu senken und
- man auf nachhaltige, unabhängige Energieerzeugung setzen möchte.
2. Welche Vorteile bringt eine PV-Anlage konkret?
- Stromkosten senken durch Eigenverbrauch
- Einspeisevergütung für überschüssigen Strom
- Steuerliche Vorteile (seit 2023 z. B. Wegfall der Umsatzsteuer)
- Wertsteigerung der Immobilie
- Beitrag zum Klimaschutz
3. Wie viel kann ich im Jahr sparen?
Das hängt vom Eigenverbrauch ab. Beispiel bei einem 4-Personen-Haushalt:
- Eigenverbrauch: ca. 30–50 %
- Jährliche Einsparung: ca. 600–1.000 €
- Zusätzlich: Einnahmen aus Einspeisung
Mit Stromspeicher kann der Eigenverbrauch auf 60–80 % steigen, was die Einsparung weiter erhöht.
4. Lohnt sich eine PV-Anlage auch ohne Speicher?
Ja. Auch ohne Speicher lohnt sich die Investition, wenn tagsüber viel Strom verbraucht wird (z. B. Homeoffice, Wärmepumpe, E-Auto).
Ein Speicher erhöht den Eigenverbrauch, ist aber mit Zusatzkosten verbunden und sollte gut kalkuliert werden.
5. Wie sieht es mit der Rentabilität aus?
Eine moderne PV-Anlage amortisiert sich meist nach 8–14 Jahren – abhängig von Strompreisen, Eigenverbrauch, Anlagengröße und Förderung.
Danach produziert sie viele Jahre fast kostenlos Strom.
6. Was ist, wenn ich nicht das perfekte Süddach habe?
Auch Dächer mit Ost-, West- oder Flachdach-Ausrichtung können sehr gute Erträge liefern. Die Technik ist inzwischen so effizient, dass sich eine PV-Anlage fast immer lohnt – selbst bei weniger idealen Bedingungen.
Fazit:
Ja, eine PV-Anlage lohnt sich in den meisten Fällen – finanziell und ökologisch.
Vor allem in Zeiten steigender Strompreise und attraktiver steuerlicher Vorteile ist der Eigenverbrauch von Solarstrom eine sehr lohnenswerte Investition.
Welche Finanzierungsmodelle sind möglich (Kauf, Kredit, Leasing, Pacht)?
1. Welche Möglichkeiten habe ich, eine PV-Anlage zu finanzieren?
Grundsätzlich gibt es vier gängige Finanzierungsmodelle:
- Direktkauf (Eigenkapital)
- Finanzierung über Kredit
- Leasingmodell
- Pacht- bzw. Mietmodell
Welches Modell am besten zu dir passt, hängt von deiner finanziellen Situation, deinen Zielen (z. B. Eigentum oder Flexibilität) und der geplanten Nutzung ab.
2. Was spricht für den Direktkauf?
Vorteile:
- Du bist sofort Eigentümer der Anlage.
- Höchste Rendite auf lange Sicht (keine Zins- oder Leasingkosten).
- Förderungen und Steuererleichterungen voll nutzbar.
Nachteile:
- Höhere Anfangsinvestition (meist 10.000–25.000 € je nach Größe/Speicher).
Ideal für: Personen mit Rücklagen, die langfristig denken und investieren wollen.
3. Wie funktioniert die Finanzierung über Kredit?
Möglichkeiten:
- Hausbank
- Umweltkredite (z. B. über die KfW – Programm 270)
- Spezialisierte Solarfinanzierer
Vorteile:
- Investition ohne Eigenkapital möglich
- Sofortige Stromkosteneinsparung trotz Ratenzahlung
- Zinsgünstige Konditionen möglich
Nachteil: Monatliche Kreditrate belastet das Haushaltsbudget.
Ideal für: Hausbesitzer mit guter Bonität, die Eigentum anstreben, aber keine vollständige Eigenfinanzierung wünschen.
4. Was ist ein Leasingmodell für PV-Anlagen?
Leasing bedeutet: Du „mietest“ die Anlage über einen festen Zeitraum (z. B. 15–20 Jahre) gegen eine monatliche Rate.
Vorteile:
- Kein hoher Investitionsaufwand
- Wartung meist inklusive
- Feste Monatsrate sorgt für Planungssicherheit
Nachteile:
- Du bist nicht Eigentümer
- Am Ende der Laufzeit kann es zu Zusatzkosten kommen (z. B. Rückbau oder Kaufoption)
Ideal für: Personen, die kein Risiko eingehen wollen oder sich nicht langfristig binden möchten.
5. Wie funktioniert das Pacht- bzw. Mietmodell?
Pacht bedeutet: Ein Anbieter (z. B. Stadtwerke oder Energieversorger) installiert die PV-Anlage auf deinem Dach. Du zahlst eine monatliche Pacht und nutzt den erzeugten Strom.
Vorteile:
- Keine oder geringe Anschaffungskosten
- Keine Wartungskosten
- Kein technisches Know-how nötig
Nachteile:
- Weniger Ersparnis im Vergleich zu Eigentum
- Langfristige Vertragsbindung (oft 20 Jahre)
- Geringerer Einfluss auf Anlagekonfiguration
Ideal für: Personen, die risikoarm in Solarenergie einsteigen wollen und keine Anfangsinvestition tätigen können oder wollen.
Fazit:
Es gibt für nahezu jede finanzielle Situation ein passendes Modell. Wer langfristig denkt und investieren kann, ist mit Kauf oder Kredit meist am besten beraten. Wer mehr Flexibilität oder geringes Risiko bevorzugt, kann auf Leasing oder Pacht setzen.
Sind Glas/Glas-Module besser wie Glas/Folie?
Die höhere Effizienz und bessere Langlebigkeit der Module sorgt dafür, dass Glas-Glas-Module häufig besonders wirtschaftlich sind. Insbesondere die Kosten für die Anlagenplanung und Installation können bei Glas-Glas-Modulen auf einen längeren Zeitraum umgelegt werden.
Egal ob Photovoltaik oder Solarthermie – die Auswahl der richtigen Module ist ein wesentliches Element bei der Planung einer solaren Anlage. Nicht zuletzt geht es dabei auch um die Wirtschaftlichkeit – und hier haben sich Glas-Glas-Module als besonders geeignet erwiesen.
Der Unterschied zu Glas-Folienmodulen liegt in erster Linie in deren Effizienz und Langlebigkeit. Bei den Glas-Glas Modulen sind die Verbindungspunkte des Solarzellenverbundes unter schützendem Glas eingebettet, was für mehr Schutz vor äußeren Einflüssen wie Temperaturen, Feuchtigkeit und Luftverschmutzung sorgt. Damit werden Leistungsverluste durch mechanische Abrieb verhindert und die Lebensdauer der Module erhöht.
Insbesondere für Investoren stellt dies einen klaren Vorteil dar: Die Kostenersparnis durch den höheren Wirkungsgrad und die längere Lebensdauer der Module kann anhand konkreter Zahlen nachgewiesen werden – und so lassen sich letztlich auch die Kosten für Anlagenplanung und Installation langfristig umlegen.
Wie erkenne ich Glas/Folie-Module und Glas/Glas-Module?
Photovoltaikmodule gibt es in unterschiedlichen Bauweisen. Die zwei gängigsten Varianten sind Glas-Folie-Module und Glas-Glas-Module. Beide schützen die Solarzellen, unterscheiden sich aber in Aufbau, Haltbarkeit und Einsatzbereich.
Woran lassen sich die Modularten erkennen?
Glas-Folie-Module haben eine Glasplatte auf der Vorderseite, während die Rückseite aus einer Kunststofffolie besteht. Von außen wirkt die Vorderseite glänzend und stabil, die Rückseite ist meist matt, leicht strukturiert oder hell. Diese Module sind leichter und in den technischen Datenblättern oft explizit als „Glas-Folie“ gekennzeichnet.
Glas-Glas-Module bestehen sowohl vorne als auch hinten aus Glas. Dadurch sehen beide Seiten ähnlich aus – meist gleichmäßig glänzend. Diese Module sind deutlich stabiler, aber auch schwerer als Glas-Folie-Module. Auch hier gibt das technische Datenblatt Aufschluss über den Aufbau.
Warum werden Glas-Glas-Module immer beliebter?
Glas-Glas-Module bieten durch den beidseitigen Glasschutz eine höhere Haltbarkeit und besseren Schutz vor Feuchtigkeit, UV-Strahlung und mechanischen Belastungen. Sie altern langsamer, zeigen weniger Leistungsverluste und haben oft eine längere Garantie von bis zu 30 Jahren. Zusätzlich sind viele Glas-Glas-Module bifazial, das heißt, sie können auch Licht von der Rückseite nutzen, was den Ertrag erhöht.
Warum sind Glas-Folie-Module trotzdem noch weit verbreitet?
Glas-Folie-Module sind günstiger in der Anschaffung und leichter zu montieren. Gerade bei privaten Dachanlagen ist das Gewicht oft ein entscheidender Faktor. Außerdem haben sie sich über viele Jahre als zuverlässig erwiesen.
Fazit:
Wer auf höchste Langlebigkeit und Effizienz setzt, wählt Glas-Glas-Module. Für Standardanwendungen mit normaler Beanspruchung bleiben Glas-Folie-Module eine gute und wirtschaftliche Wahl. Die Entscheidung hängt von den individuellen Anforderungen und dem Budget ab.
Bei Fragen zu passenden Modultypen beraten wir gerne individuell – einfach Kontakt aufnehmen.
Was ist ein Notstromfähiger Wechselrichter?
Ein notstromfähiger Wechselrichter ist eine Komponente, die bei der Notstromversorgung zum Einsatz kommen kann. In Verbindung mit einem Stromspeicher ermöglicht ein geeigneter Wechselrichter es, dass bestimmte Verbraucher bei Stromausfall an einem separaten Ausgang des Wechselrichters weiterhin mit Strom versorgt werden – beispielsweise über eine normale Notstromsteckdose.
Doch wie unterscheidet sich diese Lösung von einem vollständigen und automatischen Notstromsystem? Bei diesem handelt es sich um ein System, dass bei Eintreten des Stromausfalls sofort auf Selbstversorgung schaltet und dabei unabhängig von den anderen Netzverbindungen arbeitet. So braucht man sich um etwaige Unterbrechungen keine Sorgen machen und man hat jederzeit Zugriff auf seinen Strom.
Braucht man einen Stromspeicher – und welchen Nutzen bringt er?
Ein Stromspeicher (meist ein Lithium-Ionen-Akku) ergänzt eine Photovoltaikanlage, indem er überschüssigen Solarstrom zwischenspeichert. Ohne Speicher wird der nicht sofort benötigte Solarstrom ins öffentliche Netz eingespeist. Mit Speicher lässt sich dieser Strom am Abend oder in der Nacht selbst verbrauchen.
Welche Vorteile bietet ein Stromspeicher?
Der wichtigste Nutzen ist die Steigerung des Eigenverbrauchs. Wer mehr vom selbst erzeugten Strom nutzt, spart mehr Stromkosten, da der Netzstrom in der Regel teurer ist als der Erlös durch die Einspeisung.
Außerdem erhöht ein Speicher die Unabhängigkeit vom Stromnetz und schützt in Verbindung mit einer Notstromfunktion auch bei Stromausfällen – etwa durch einen automatischen Netztrennschalter.
Wann lohnt sich ein Speicher besonders?
Ein Speicher ist sinnvoll, wenn tagsüber viel Solarstrom erzeugt, aber wenig verbraucht wird – etwa in Haushalten, die morgens und abends aktiv sind. Auch bei steigenden Strompreisen und sinkender Einspeisevergütung gewinnt der Eigenverbrauch an Bedeutung.
Braucht jede PV-Anlage einen Speicher?
Nein, ein Speicher ist nicht zwingend notwendig. Wer einen Großteil seines Stroms tagsüber nutzt (z. B. durch Homeoffice oder Wärmepumpe), kann auch ohne Speicher hohe Einsparungen erzielen. Speicher sind eine zusätzliche Investition, die sich meist nach einigen Jahren rechnet – abhängig von Stromverbrauch, Anlagengröße und Speicherkapazität.
Ein Stromspeicher erhöht die Unabhängigkeit und die Wirtschaftlichkeit einer PV-Anlage. Ob sich die Investition lohnt, hängt vom individuellen Verbrauchsverhalten und den Kosten ab.
Wie lange reicht ein 10 kWh Speicher?
Ein voller Speicher mit einer optimalen Leistung von 10 kWh hält demnach gut eineinhalb Tage, wenn man alles so verbraucht wie gewohnt. Reduziert man den Verbrauch auf ein Minimum, also verzichtet auf Waschmaschine, Trockner oder Spülmaschine, kann so ein Speicher bis zu drei Tage halten.
Ein 10 kWh Speicher kann eine effektive Möglichkeit sein, den Strom zu speichern, den Ihre Solaranlage erzeugt. Doch wie lange reicht ein solcher Speicher?
Generell hält ein voller 10 kWh Speicher gut eineinhalb Tage lang bei normalen Verbrauchsgewohnheiten. Wer allerdings auf Waschmaschine und Co. verzichtet und sich auf das absolute Minimum beschränkt, kann diese Zeitspanne sogar auf bis zu drei Tage maximieren. Darüber hinaus ist es vor allem im Sommer ratsam, den Verbrauch an elektrischen Geräten so gering wie möglich zu halten, um die Autarkie der Anlage aufrechtzuerhalten.
Doch ohne Frage sind gerade 10 kWh Speicher eine Investition in die Zukunft: Durch ihren Einsatz sind Sie unabhängig von störungsanfälligen Stromnetzen – unabhängiger als je zuvor!
Wie viel kWp für Speicher?
Als Faustformel kann man sagen, dass die Speicherkapazität in Kilowattstunden zwischen 0,9 bis 1,6 mal der Leistung der Anlage in kWpeak entspricht. Also bei einer PV-Anlage mit 5 kWp zwischen 4 und 8 kWh Speicherkapazität
Wer Solarenergie nutzen möchte, steht vor der Frage, wie groß der dazu benötigte Speicher sein sollte. Eine einfache Faustformel kann hierhin hingewiesen werden: Die Speicherkapazität in Kilowattstunden entspricht zwischen 0,9 und 1,6 mal der Leistung der Anlage in kW peak.
Bei einer PV-Anlage mit 5 kWp sind das also 4 bis 8 kWh Speicherkapazität. Doch auch bei einem größeren System sollten Sie nicht mehr als 1,6 mal die Leistung des Solarstromsystems annehmen. Je höher die Speichergröße ist – desto höhere Kosten fallen in diesem Fall an.
Daher lohnt es sich im Vorfeld abzuwägen: Welche Anschaffungskosten für den Akku tragen sich wieder und welcher Nutzen entsteht? Dabei helfen verschiedene Rechnungsprogramme, die Ihnen unter anderem mithilfe von Verbrauchsdaten und Eigenverbrauchswerte konkrete Aufschlüsse geben können.
Wie viel Strom produziert eine 10 kWp Photovoltaikanlage am Tag?
Eine 10-kWp-Photovoltaikanlage produziert normalerweise etwa 9.700 kWh Strom pro Jahr. Das entspricht im Schnitt etwa 27 kWh Strom pro Tag.
Photovoltaikanlagen sind eine großartige Möglichkeit zur Nutzung erneuerbarer Energien. Eine 10-kWp-Photovoltaikanlage ist hierbei eine häufig gewählte Größe, da sie ein ausgezeichnetes Verhältnis zwischen Kosten und Leistung bietet. Wie viel Strom produziert so eine Anlage am Tag?
Eine 10-kWp-Photovoltaikanlage produziert normalerweise etwa 9.700 kWh Strom pro Jahr – im Durchschnitt also etwa 27 kWh pro Tag. Dieser ungefähre Wert kann je nach Standort, Wetterbedingungen, Marktsituation und anderen Faktoren variieren, aber mit diesem Wissen können Sie Ihren Stromverbrauch optimal auf die Produktionsmenge anpassen.
Darüber hinaus ist es lohnenswert, das Potenzial der Photovoltaik noch mehr zu nutzen: Mit dem Einsatz von modernen Speichern können Sie den selbst produzierten Strom speichern und somit noch flexibler für den eigenen Bedarf nutzen – Solarstrom für jeden Tag!
Wie funktioniert eine PV Anlage?
Der grundlegende Prozess einer Photovoltaikanlage beginnt direkt im Solarmodul – genauer gesagt in den Solarzellen, aus denen das Modul besteht. Diese Zellen bestehen meist aus Silizium, einem Halbleitermaterial, das besondere elektrische Eigenschaften besitzt. Trifft Sonnenlicht auf die Oberfläche der Zellen, werden durch die Energie der Photonen Elektronen im Material angeregt – sie lösen sich aus ihren Atomen und können sich frei bewegen.
Durch eine spezielle Anordnung der Materialien innerhalb der Solarzelle – eine sogenannte p-n-Übergangsschicht – entsteht ein elektrisches Feld, das die Elektronen in eine bestimmte Richtung lenkt. Es bildet sich ein Gleichstrom, sobald ein geschlossener Stromkreis besteht, z. B. durch das Anschließen eines Verbrauchers. Diese direkte Umwandlung von Licht in elektrische Energie wird als „photovoltaischer Effekt“ bezeichnet.
Mehrere Solarzellen werden zu einem Modul verbunden, mehrere Module wiederum zu einem Strang (String) verschaltet. Die elektrische Energie, die dabei entsteht, ist zunächst Gleichstrom (DC) und kann im Haushalt so noch nicht genutzt werden. Deshalb übernimmt ein Wechselrichter die Aufgabe, diesen Strom in haushaltsüblichen Wechselstrom (AC) umzuwandeln. Danach kann der Strom im eigenen Haus verwendet, in einem Speicher zwischengespeichert oder ins öffentliche Netz eingespeist werden.
Mit diesem System nutzt du Sonnenlicht direkt zur Energiegewinnung – leise, emissionsfrei und wartungsarm. Moderne Photovoltaikanlagen sind somit nicht nur ein Beitrag zum Klimaschutz, sondern auch ein wichtiger Schritt zur eigenen Stromunabhängigkeit.
Kann ich meine PV-Anlage mit einer Wallbox verbinden?
Ja, das ist nicht nur möglich, sondern besonders sinnvoll, wenn du ein Elektroauto besitzt. Die Verbindung deiner PV-Anlage mit einer Wallbox ermöglicht es dir, dein Auto mit selbst erzeugtem Solarstrom zu laden – nachhaltig, günstig und direkt vor der Haustür. Dabei gibt es einen wichtigen Unterschied zwischen einer normalen Ladung und der sogenannten PV-Überschussladung.
Eine normale Wallbox lädt dein Auto unabhängig von der aktuellen Stromquelle – also auch dann, wenn gerade kein oder nur wenig Solarstrom erzeugt wird. In dem Fall wird der Strom einfach aus dem Netz bezogen, wie bei jeder anderen Steckdose auch. Du profitierst hier zwar von der Bequemlichkeit des Heimladens, nutzt aber nicht unbedingt deinen eigenen Solarstrom.
Die PV-Überschussladung hingegen ist besonders clever: Hier wird nur der Strom verwendet, den deine Photovoltaikanlage aktuell nicht für den Haushalt oder den Speicher benötigt – also der Überschuss, der sonst ins öffentliche Netz eingespeist würde. Um das zu ermöglichen, ist ein intelligentes Energiemanagement nötig. Dieses misst den aktuellen Eigenverbrauch, erkennt freien PV-Strom und steuert die Wallbox so, dass das Auto nur dann lädt, wenn tatsächlich PV-Überschuss vorhanden ist.
Solche Systeme können sogar dynamisch arbeiten: Sie passen die Ladeleistung des Autos an die aktuelle Solarstromproduktion an – zum Beispiel bei wolkigem Wetter oder wenn große Verbraucher im Haus aktiv sind. Damit wird dein Eigenverbrauch maximiert und dein Netzbezug minimiert.
Mit einer geeigneten Wallbox, einem kompatiblen Wechselrichter und einem Energiemanager lässt sich dein E-Auto intelligent in dein PV-System einbinden. Das spart nicht nur Stromkosten, sondern steigert auch deine Autarkie – und macht das Laden besonders umweltfreundlich. Wichtig ist, bei der Planung die passende Hardware zu wählen, damit alle Komponenten optimal zusammenspielen.
Kann ich die Leistung meiner Anlage nachträglich erweitern?
Grundsätzlich ja – eine Erweiterung deiner bestehenden Photovoltaikanlage ist in vielen Fällen möglich. Dabei kommt es auf verschiedene Faktoren an: Ist noch ausreichend freie Dachfläche vorhanden? Hat der Wechselrichter genügend Reserven für zusätzliche Module oder müsste er ausgetauscht werden? Und wie ist der aktuelle Netzanschluss dimensioniert?
Auch das verwendete System spielt eine wichtige Rolle: Bei Solaredge-Anlagen mit Leistungsoptimierern ist eine Erweiterung besonders flexibel möglich – hier lassen sich Module meist einzeln ergänzen und unabhängig voneinander betreiben. Bei klassischen String-Systemen müssen hingegen in der Regel mindestens 6 Module hinzugefügt werden, um einen neuen String zu bilden, der technisch sinnvoll arbeitet. Das kann die Planung etwas einschränken – ist aber bei durchdachter Auslegung ebenfalls gut realisierbar.
Wenn du deine Anlage bereits mit einem Batteriespeicher oder einer Wallbox betreibst, kann eine Erweiterung auch diese Komponenten betreffen. Viele Systeme sind modular aufgebaut und lassen sich flexibel anpassen. Wichtig ist jedoch, dass eine technische Prüfung durch einen Fachbetrieb erfolgt, um sicherzustellen, dass alle Komponenten weiterhin optimal zusammenarbeiten und gesetzliche Vorgaben eingehalten werden.
Auch steuerliche und fördertechnische Aspekte spielen eine Rolle – insbesondere, wenn die ursprüngliche Anlage schon einige Jahre in Betrieb ist. Eine Erweiterung kann unter Umständen Einfluss auf die Einspeisevergütung oder Meldepflichten beim Netzbetreiber haben.
Tipp: Sprich frühzeitig mit uns. Mit der richtigen Planung kannst du deine PV-Anlage zukunftssicher ausbauen – zum Beispiel, wenn dein Strombedarf durch E-Mobilität oder Wärmepumpe gestiegen ist.
Was bedeuten Ladezyklen und wie viele haben verschiedene Batterien im PV-Bereich?
Was sind Ladezyklen?
Ein Ladezyklus beschreibt einen vollständigen Entlade- und anschließenden Ladevorgang einer Batterie – also z. B. wenn eine Batterie von 100 % auf 0 % entladen und danach wieder auf 100 % geladen wird. Auch mehrere Teilentladungen, die in Summe 100 % ergeben, zählen als ein Ladezyklus.
Warum sind Ladezyklen wichtig?
Die Anzahl der Ladezyklen gibt an, wie oft eine Batterie genutzt werden kann, bevor ihre Kapazität deutlich nachlässt. Je mehr Ladezyklen eine Batterie verträgt, desto langlebiger und wirtschaftlicher ist sie.
Hier sind die Zyklenzahlen der Batteriespeicher unserer Partner:
– RCT: 5000 Ladezyklen
– SMA: 8000 Ladezyklen
– BYD: 6000 Ladezyklen
– Enphase: 6000 Ladezyklen
– Sungrow SBR: 6000 Ladezyklen
– HUAWAI: 6000 Ladezyklen
– Goodwe: 6000 Ladezyklen
– Pylontech: 8000 Ladezyklen
– Solaredge: 6000 Ladezyklen
– ALPHA ESS: 10000+ Ladezyklen
Kann eine PV-Anlage vom Netz getrennt werden? Was bedeutet automatischer bzw. manueller Notstromschalter?
Normale PV-Anlagen ohne spezielle Zusatzfunktionen schalten sich bei einem Stromausfall automatisch ab. Dies dient dem Netz- und Personenschutz, da bei Wartungsarbeiten niemand gefährdet werden soll. Eine netzunabhängige Versorgung ist in diesem Fall nicht möglich.
Um bei einem Stromausfall dennoch weiterhin elektrische Energie nutzen zu können, ist eine Notstromfunktion notwendig. Dabei wird zwischen manuellem und automatischem Notstromschalter unterschieden.
Ein manueller Notstromschalter erfordert im Falle eines Stromausfalls einen händischen Eingriff. Erst nach dem Umlegen des Schalters wird der Haushalt vom Netz getrennt und auf den sogenannten Inselbetrieb umgestellt. Erst dann kann die Batterie bzw. PV-Anlage wieder Strom liefern – in der Regel jedoch nur für ausgewählte Stromkreise. (Kosten: ca. 500€ )
Ein automatischer Notstromschalter übernimmt diesen Vorgang eigenständig. Sobald das öffentliche Stromnetz ausfällt, erfolgt die Umschaltung innerhalb weniger Sekunden automatisch. Dadurch bleibt die Stromversorgung für kritische Verbraucher nahezu unterbrechungsfrei. (Kosten: ca. 1.000€-1500€ – abhängig des Herstellers )
In beiden Fällen ist die Notstromversorgung meist auf bestimmte Stromkreise begrenzt. Welche Geräte im Notstrombetrieb versorgt werden können, hängt von der Leistung der Batterie und der Konfiguration der Anlage ab.
Kann ich eine PV-Anlage mit einer Wärmepumpe kombinieren?
Ja, die Kombination aus Photovoltaik-Anlage und Wärmepumpe ist nicht nur möglich, sondern auch besonders sinnvoll.
Warum macht die Kombination Sinn?
Eine Wärmepumpe benötigt Strom, um Wärme aus der Umgebung (Luft, Erde oder Wasser) für Heizung und Warmwasser zu erzeugen. Mit einer PV-Anlage kann dieser Strom umweltfreundlich und kostengünstig direkt auf dem eigenen Dach produziert werden.
Durch die Kopplung beider Systeme entsteht eine effiziente Eigenversorgung, die:
- den Stromverbrauch der Wärmepumpe abdeckt
- die Energiekosten deutlich senkt
- den CO₂-Ausstoß reduziert
- den Eigenverbrauch des Solarstroms erhöht, was die Wirtschaftlichkeit der PV-Anlage verbessert
Wie funktioniert das Zusammenspiel?
- Die PV-Anlage produziert tagsüber Strom.
- Die Wärmepumpe kann automatisch dann laufen, wenn genügend PV-Überschuss vorhanden ist.
- Ein Energiemanagement-System oder ein Smart-Home-System kann die Wärmepumpe gezielt ansteuern – zum Beispiel zur Warmwasserbereitung in sonnenreichen Stunden.
- Optional kann ein Batteriespeicher helfen, auch abends oder nachts PV-Strom für die Wärmepumpe zu nutzen.
Was bringt mir das finanziell?
- Ein höherer Eigenverbrauch bedeutet mehr Ersparnis, da selbst erzeugter Strom günstiger ist als Netzstrom.
- Je nach Wärmepumpentyp (Luft-Wasser, Sole-Wasser etc.) und Dämmstandard des Hauses kann eine Eigenverbrauchsquote von 40 bis 60 Prozent erreicht werden.
- Fördermöglichkeiten und steuerliche Vorteile machen die Kombination zusätzlich attraktiv.
Was muss ich beachten?
- Die Dimensionierung von PV-Anlage und Wärmepumpe sollte aufeinander abgestimmt sein.
- Ein intelligentes Energiemanagement ist empfehlenswert.
- Wärmepumpen mit PV-Optimierung oder SG-Ready-Funktion sind besonders gut geeignet.
- In Altbauten hängt die Effizienz stark vom Zustand des Gebäudes und dem Heizsystem ab.
Fazit:
Die Kombination von PV-Anlage und Wärmepumpe ist eine zukunftssichere, klimafreundliche Lösung, mit der Sie Ihre Energieversorgung deutlich günstiger und unabhängiger gestalten können.
Sie haben Fragen oder möchten eine individuelle Beratung?
Wir helfen Ihnen gerne, Ihre PV-Anlage optimal auf Ihre Wärmepumpe abzustimmen.
Was ist der Unterschied zwischen kWp und kWh?
In der Photovoltaik stolpert man immer wieder über zwei Begriffe: kWp und kWh. Obwohl sie ähnlich klingen, beschreiben sie unterschiedliche Dinge – und sind beide wichtig für das Verständnis einer Solaranlage.
1. Was bedeutet kWp?
kWp steht für Kilowatt-Peak – also die maximale elektrische Leistung einer Photovoltaikanlage unter sogenannten Standard-Testbedingungen (STC).
Es ist ein Leistungswert und beschreibt, wie viel Strom eine PV-Anlage theoretisch erzeugen kann, wenn die Sonne perfekt scheint (1.000 W/m² Einstrahlung, 25 °C Modultemperatur).
Beispiel:
Eine PV-Anlage mit 10 kWp kann unter optimalen Bedingungen kurzfristig bis zu 10 Kilowatt Strom erzeugen.
2. Was bedeutet kWh?
kWh steht für Kilowattstunde – das ist eine Maßeinheit für Energie.
Sie gibt an, wie viel Strom verbraucht oder erzeugt wurde.
Beispiel:
Wenn eine Solaranlage eine Stunde lang konstant 5 Kilowatt Leistung bringt, hat sie 5 kWh Strom erzeugt.
Der Unterschied auf einen Blick:
Begriff | Bedeutung | Einheit | Typ |
kWp | Maximale Leistung der PV-Anlage | Kilowatt-Peak | Leistung |
kWh | Tatsächlich erzeugte oder verbrauchte Strommenge | Kilowattstunde | Energie |
Welche Komponenten gehören zu einer PV-Anlage?
Eine Photovoltaikanlage besteht aus mehreren zentralen Bauteilen, die zusammenarbeiten, um Sonnenlicht in nutzbaren Strom umzuwandeln. Im Folgenden geben wir einen Überblick über die wichtigsten Komponenten einer PV-Anlage:
1. Solarmodule
Die Solarmodule sind das Herzstück der Anlage. Sie wandeln Sonnenlicht in Gleichstrom um.
Es gibt unterschiedliche Modultypen (z. B. monokristallin, polykristallin), wobei heute überwiegend leistungsstarke monokristalline Module verwendet werden.
Aufgabe:
Erzeugung von Strom durch die Energie der Sonne.
2. Wechselrichter
Da Haushaltsgeräte Wechselstrom (AC) benötigen, der von den Modulen aber Gleichstrom (DC) kommt, übernimmt der Wechselrichter die Umwandlung.
Zudem überwacht er die Leistung der Anlage und speist den Strom ins Hausnetz oder ins öffentliche Netz ein.
Aufgabe:
Umwandlung von Gleichstrom in Wechselstrom und Überwachung der Systemleistung.
3. Batteriespeicher (optional)
Ein Stromspeicher ist nicht zwingend erforderlich, aber besonders sinnvoll, wenn man den Eigenverbrauch erhöhen und sich unabhängiger vom Netzstrom machen möchte.
Der Speicher speichert überschüssigen Solarstrom und stellt ihn z. B. abends oder nachts zur Verfügung.
Aufgabe:
Zwischenspeicherung des erzeugten Stroms für eine spätere Nutzung.
4. Montagesystem
Das Montagesystem sorgt für die sichere und stabile Befestigung der Solarmodule – auf dem Dach (Schrägdach oder Flachdach), an der Fassade oder auf dem Boden.
Es besteht aus Schienen, Haltern und Klemmen, angepasst an Dachtyp und Statik.
Aufgabe:
Tragkonstruktion für die Solarmodule – angepasst an das jeweilige Gebäude.
5. Energiemanagement-System (optional)
Ein EMS steuert den Energiefluss im Haus intelligent. Es kann Verbraucher wie Wallboxen, Wärmepumpen oder Speicher so ansteuern, dass möglichst viel eigener Solarstrom verbraucht wird.
Aufgabe:
Optimierung des Eigenverbrauchs durch gezielte Steuerung von Stromflüssen.
Eine PV-Anlage besteht aus mehr als nur Modulen auf dem Dach. Erst das Zusammenspiel von Modulen, Wechselrichter, Speicher und Montagesystem – ergänzt durch intelligente Steuerung – ermöglicht eine effiziente, nachhaltige Stromversorgung.
Wie viel Strom erzeugt meine Photovoltaikanlage – und was beeinflusst den Ertrag (Ausrichtung, Wetter, Dachneigung)?
Die Strommenge, die eine PV-Anlage produziert, hängt von mehreren Faktoren ab. Natürlich spielt die Größe der Anlage eine Rolle – je mehr Solarmodule installiert sind, desto mehr Strom kann theoretisch erzeugt werden. Doch das ist nur ein Teil der Geschichte.
Ausrichtung und Neigung des Dachs sind entscheidend: Optimal ist eine Südausrichtung, da die Sonne so am längsten und intensivsten auf die Module scheint. Aber auch Südost oder Südwest funktionieren gut. Bei Dachneigungen zwischen etwa 25 und 35 Grad ist der Ertrag in unseren Breiten meist am höchsten. Flachere oder steilere Winkel können den Ertrag reduzieren.
Das Wetter hat ebenfalls großen Einfluss. Sonnige, klare Tage bringen natürlich viel Strom. Wolken, Regen oder Schnee verringern die Leistung. An bewölkten Tagen kann der Ertrag auf nur 10–30 % der Maximalleistung sinken.
Verschattung durch Bäume, Nachbargebäude oder Schornsteine ist oft ein unterschätzter Faktor – schon kleine Schattenbereiche können den Stromertrag stark mindern, da die Module dann nicht mehr optimal arbeiten.
Weitere Einflüsse sind die Temperatur (sehr heiße Module arbeiten weniger effizient) und die Sauberkeit der Module. Staub oder Schmutz reduzieren die Lichtaufnahme.
Kurz gesagt: Die tatsächliche Stromproduktion einer PV-Anlage variiert je nach Standort, Ausrichtung, Wetter und Pflege. Für eine realistische Einschätzung lohnt es sich, die örtlichen Bedingungen genau zu prüfen und die Anlage regelmäßig zu warten.
Funktioniert meine PV-Anlage bei Stromausfall oder Blackout?
Viele Besitzer einer Photovoltaikanlage fragen sich, ob ihre Solaranlage auch dann Strom liefert, wenn das öffentliche Netz ausfällt. Die Antwort ist: Im Normalfall nein.
Die meisten PV-Anlagen sind so konzipiert, dass sie bei einem Stromausfall automatisch abschalten. Das dient vor allem dem Schutz von Netztechnikern, die sonst beim Arbeiten an der Leitung von einer „ins Netz einspeisenden“ Anlage gefährdet werden könnten. Dieses Sicherheitsfeature nennt man „Inselbetriebsschutz“.
Gibt es Ausnahmen?
Ja, mit einem sogenannten Notstromschalter und einem passenden Batteriespeicher kann die PV-Anlage auch unabhängig vom Netz Strom liefern – beispielsweise für bestimmte Steckdosen oder Verbraucher im Haus. Der Notstromschalter trennt bei einem Ausfall automatisch das Hausnetz vom öffentlichen Netz und ermöglicht so die Stromversorgung aus der PV-Anlage und dem Speicher.
Blackout und PV-Anlage
Bei einem großflächigen, längeren Blackout ist eine normale PV-Anlage ohne Speicher und Notstromschalter meist nutzlos, da sie nur dann Strom produziert, wenn sie auch ins Netz einspeisen kann. Systeme mit Batteriespeicher und Notstromschalter können hier helfen, sind aber mit höheren Kosten verbunden.
Wer im Ernstfall autark bleiben möchte, sollte eine PV-Anlage mit geeignetem Speicher und Notstromschalter planen. Für die meisten Anwender reicht eine Standardanlage ohne Netzanschlussbetrieb aus.
Welcher Standort ist optimal für den Wechselrichter?
Der Wechselrichter ist das Herzstück einer Photovoltaikanlage, da er den von den Solarmodulen erzeugten Gleichstrom in nutzbaren Wechselstrom umwandelt. Damit er zuverlässig funktioniert und eine lange Lebensdauer hat, ist der richtige Standort entscheidend.
Optimal ist ein trockener, gut belüfteter und frostfreier Ort, wie zum Beispiel der Keller, die Garage oder ein Technikraum im Haus. Wichtig ist, dass der Wechselrichter nicht direkter Sonneneinstrahlung oder Feuchtigkeit ausgesetzt ist, da hohe Temperaturen und Nässe die Leistung und Lebensdauer beeinträchtigen können. Auch eine gute Zugänglichkeit sollte gewährleistet sein, damit Wartungen und Kontrollen einfach durchgeführt werden können. Manche Anlagenbetreiber montieren den Wechselrichter auch an einer wettergeschützten Hauswand, wobei darauf geachtet werden muss, dass er ausreichend vor Regen und starker Sonne geschützt ist. Insgesamt gilt: Ein geschützter und gut erreichbarer Platz ist ideal für den Wechselrichter.
Wie sicher und langlebig sind Module & Technik – inkl. Garantiefristen?
Die Solarmodule und technischen Komponenten moderner Photovoltaikanlagen sind in der Regel sehr langlebig und zuverlässig. Hochwertige Module besitzen eine Lebensdauer von 25 bis 30 Jahren und länger. Die meisten Hersteller geben heute eine Produktgarantie von 15 bis 25 Jahren auf die Module. Diese Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler ab. Darüber hinaus gibt es eine Leistungsgarantie, die sicherstellt, dass die Module nach 25 oder sogar 30 Jahren noch einen Großteil ihrer ursprünglichen Leistung – meist 80 bis 87 % – erreichen.
Auch andere Komponenten wie Wechselrichter und Speicher haben eine lange Lebensdauer, jedoch oft etwas kürzere Garantiezeiten. Wechselrichter werden meist mit 5 bis 10 Jahren Garantie angeboten, bei manchen Herstellern kann diese Garantie optional verlängert werden. Batteriespeicher besitzen in der Regel 10 Jahre Garantie und eine garantierte Anzahl von Ladezyklen.
Wie langlebig die Anlage tatsächlich ist, hängt neben der Qualität der Bauteile auch von der fachgerechten Installation und regelmäßigen Wartung ab. Wer auf bewährte Hersteller setzt – wie beispielsweise auf die auf der genannten Website aufgeführten Marken –, kann mit einer hohen Zuverlässigkeit und einer sehr langen Nutzung der PV-Anlage rechnen.
Moderne PV-Module und Technik sind für jahrzehntelangen Betrieb ausgelegt. Die Garantiezeiten zeigen, dass die Hersteller selbst von der Langlebigkeit ihrer Produkte überzeugt sind. Für eine passende Produktauswahl und Garantieberatung unterstützen wir gerne persönlich – einfach Kontakt aufnehmen.
Was passiert am Ende der Lebensdauer – Recycling & Entsorgung?
Photovoltaikanlagen sind für eine lange Lebensdauer von 25 bis 30 Jahren oder mehr ausgelegt. Doch auch danach müssen Module und Technik fachgerecht entsorgt oder recycelt werden. Solarmodule bestehen überwiegend aus Glas, Aluminium, Silizium und Kunststoffen – also Materialien, die größtenteils wiederverwertet werden können. In Europa regelt die WEEE-Richtlinie (Waste Electrical and Electronic Equipment), dass Hersteller alte Module zurücknehmen und einer umweltgerechten Verwertung zuführen müssen.
Der Recyclingprozess unterscheidet sich je nach Modultyp: Glas-Folie-Module sind etwas aufwendiger zu recyceln, weil die Folie auf der Rückseite fest verklebt ist. Diese Verklebung muss im Recyclingprozess zunächst thermisch oder chemisch gelöst werden, bevor die wertvollen Rohstoffe wie Glas und Metalle zurückgewonnen werden können. Glas-Glas-Module sind dagegen einfacher zu recyceln, da sie fast vollständig aus Glas und Metall bestehen und weniger Verbundstoffe enthalten.
Auch Wechselrichter und Batteriespeicher müssen nach vielen Jahren ersetzt und fachgerecht entsorgt werden. Für Batterien gelten separate gesetzliche Vorgaben, da sie als Sonderabfall klassifiziert sind. Spezialisierte Entsorgungsbetriebe übernehmen die sichere Verarbeitung und Rohstoffrückgewinnung.
Latten oder Sparren - wo und warum wird eine PV-Anlage befestigt?
Bei der Montage einer Photovoltaikanlage auf einem Ziegeldach werden die Dachhaken in der Regel an den Dachsparren befestigt. Die Sparren tragen zwar selbst keine hohen Lasten, aber durch ihre gleichmäßige Verteilung über die gesamte Dachfläche bieten sie einen flexibleren Montagepunkt für die Haken. Wichtig ist dabei, dass die Dachsparren in gutem Zustand sind und die auftretenden Kräfte sicher in die Dachkonstruktion ableiten.
Der Vorteil der Befestigung an den Sparren: Die Haken können freier positioniert werden. So lassen sich die Modulreihen flexibler planen, und eine gleichmäßige Lastverteilung wird leichter erreicht. Die Sparren sind dafür ausgelegt, die auf die Dachdeckung wirkenden Kräfte sowie das Gewicht der PV-Anlage aufzunehmen, solange die Montage fachgerecht ausgeführt wird.
Zusammengefasst: Die meisten PV-Anlagen werden an den Dachsparren befestigt, da dies eine flexible, sichere und statisch ausreichende Lösung darstellt. Entscheidend ist die fachgerechte Montage und eine Lastverteilung über mehrere Sparren hinweg.
Wie aufwendig ist die Wartung und Instandhaltung einer PV-Anlage?
Muss eine Photovoltaikanlage regelmäßig gewartet werden?
Photovoltaikanlagen sind grundsätzlich sehr wartungsarm. Hochwertige Anlagen sind für einen zuverlässigen Betrieb von 20 bis 30 Jahren ausgelegt. Regelmäßige Sichtprüfungen und gelegentliche Wartungen erhöhen aber die Lebensdauer und den Ertrag.
Welche Wartungsarbeiten sind sinnvoll?
- Sichtkontrolle: 1 Mal jährlich sollte die Anlage auf offensichtliche Schäden (z. B. durch Sturm, Hagel oder Vogelnester) geprüft werden.
- Reinigung der Module: Normalerweise reinigt der Regen die Module ausreichend. In stark staubigen Gegenden oder bei starkem Pollenflug kann eine professionelle Reinigung alle 2–5 Jahre sinnvoll sein.
- Technische Kontrolle: Der Wechselrichter und die Verkabelung sollten regelmäßig geprüft werden. Einige Hersteller empfehlen eine Fachwartung alle 5 Jahre.
- Ertragskontrolle: Über ein Monitoring-System (oft per App) können Sie die Stromproduktion im Blick behalten und frühzeitig Störungen erkennen.
.
Was passiert bei einem Defekt?
Die meisten Komponenten haben lange Garantiezeiten (Module oft 25-30 Jahre, Wechselrichter 5–10 Jahre). Im Garantiefall werden defekte Bauteile in der Regel kostenlos ersetzt.
Fazit:
Eine PV-Anlage auf dem Dach benötigt wenig Wartung. Wer regelmäßig prüft und kleinere Probleme frühzeitig behebt, kann jahrzehntelang zuverlässig eigenen Solarstrom produzieren – wartungsarm, wirtschaftlich und nachhaltig.
Wie groß muss die PV-Anlage sein, um autark zu werden?
Autark zu sein bedeutet, den gesamten Strombedarf eines Haushalts zu 100 % selbst zu decken, also vollständig unabhängig vom öffentlichen Stromnetz zu sein. Die Photovoltaikanlage erzeugt den benötigten Strom, ein Batteriespeicher sorgt dafür, dass auch nachts oder an sonnenarmen Tagen genügend Energie zur Verfügung steht.
Wie groß die PV-Anlage dafür sein muss, hängt vom individuellen Stromverbrauch ab. Ein durchschnittlicher Haushalt verbraucht rund 3.500 bis 5.000 Kilowattstunden (kWh) pro Jahr. Um diesen Bedarf vollständig selbst zu decken, müsste die PV-Anlage groß genug sein, um auch im Winter genug Strom zu produzieren – die schwierigste Zeit im Jahr. Da die Solarerträge im Winter geringer sind, wäre eine entsprechend große Überdimensionierung der Anlage und ein sehr großer Speicher notwendig, was technisch möglich, aber oft wirtschaftlich nicht sinnvoll ist.
In der Praxis streben viele Haushalte deshalb nicht die komplette Autarkie an, sondern einen hohen Eigenversorgungsgrad. Mit einer gut geplanten PV-Anlage und einem Stromspeicher sind Autarkiegrade von 60 bis 80 % realistisch, in manchen Fällen auch etwas mehr.
Für eine vollständige Autarkie müsste die Anlage sehr groß und der Speicher entsprechend dimensioniert sein – das lohnt sich in den wenigsten Fällen. Eine wirtschaftlich sinnvolle Lösung deckt den Großteil des Strombedarfs selbst ab, bezieht aber in Spitzenzeiten weiterhin Strom aus dem Netz.
Wird Strom 2025 billiger?
Wird der Strompreis 2025 sinken?
Ja, für viele Haushalte in Deutschland sind die Strompreise 2025 im Vergleich zum Vorjahr etwas gesunken. Grund dafür sind vor allem die gesunkenen Großhandelspreise für Strom und regionale Anpassungen bei den Netzentgelten.
Warum ist Strom günstiger geworden?
- Die Einkaufspreise an den Strombörsen sind nach dem Energiepreisschock 2022/2023 wieder gefallen.
- Die EEG-Umlage wurde bereits 2022 abgeschafft, wodurch die Preise dauerhaft entlastet werden.
- Teilweise wurden die Netzentgelte gesenkt, besonders in Regionen mit viel erneuerbarem Strom.
Wie viel günstiger wird Strom 2025?
Die Preise liegen 2025 je nach Tarif und Anbieter oft 10–20 % unter dem Niveau von 2023/2024. Statt über 40 Cent pro Kilowattstunde zahlen viele Haushalte nun zwischen 28 und 38 Cent/kWh. Die tatsächliche Ersparnis hängt stark vom Wohnort und vom gewählten Tarif ab.
Gibt es regionale Unterschiede?
Ja, in Nord- und Ostdeutschland fallen die Netzentgelte teils stärker, weil dort besonders viel Windstrom ins Netz eingespeist wird. In anderen Regionen bleiben die Kosten etwas höher.
Könnte der Strompreis wieder steigen?
Langfristig ist ein leichter Anstieg möglich, zum Beispiel durch steigende Netzentgelte, Investitionen in das Stromnetz oder neue Steuern und Umlagen. Auch geopolitische Krisen können den Großhandelspreis wieder nach oben treiben.
Fazit:
2025 ist Strom für viele Verbraucher günstiger als in den Vorjahren. Wer aktiv den Anbieter wechselt, kann zusätzlich sparen. Langfristig bleibt der Strompreis aber volatil – Einsparungen durch eigenen Solarstrom oder sparsamen Verbrauch bleiben weiterhin sinnvoll.
Wird Strom jemals wieder günstiger?
Wird Strom auch wieder billiger? Von dauerhaft sinkenden Strompreisen ist nicht auszugehen. Die Stromunternehmen rechnen damit, dass Strom auf mittlere Sicht im Vergleich zu Vorkrisen-Zeiten um den Faktor zwei teurer sein wird.
Auch wenn die Debatte um steigende Strompreise vielerorts in den Vordergrund rückt, so ist doch von einer dauerhaft sinkenden Entwicklung des Verbraucherstrompreises nicht auszugehen. Denn laut Prognosen der Stromunternehmen rechnen diese damit, dass der Strompreis auf mittlere Sicht im Vergleich zu Vorkrisen-Zeiten um den Faktor zwei teurer sein wird.
Dies liegt an mehreren Faktoren: Zum einen muss Geld für den Netzausbau und Erneuerung investiert werden, etwa im Bereich Offshore-Windparks oder Photovoltaikanlagen. Hinzu kommen Steuern und Abgaben sowie Abschläge auf Ökostrom, die seit Jahren stetig ansteigen. Last but not least ist auch der allgemein steigende Energiepreis ein Grund dafür, dass Strompreise nach oben gehen – besonders beim Erdgas sind hier starke Anstiege zu verzeichnen.
Letztlich bleibt abzuwarten, welche Entwicklung die Energiemärkte in den kommenden Monaten und Jahren noch nehmen. Klar ist jedoch schon jetzt, dass sich die Preise in den nächsten Jahren voraussichtlich nicht mehr erheblich senken werden – eine Rückkehr zur Zeit vor 2020 sollte man daher leider nicht erwarten.
Was tun bei Verschattung oder Norddach?
Auch wenn dein Dach nicht komplett nach Süden ausgerichtet ist oder es zu Verschattungen kommt, ist eine Photovoltaikanlage häufig trotzdem wirtschaftlich sinnvoll – mit der richtigen Planung und Technik.
Teilverschattungen, etwa durch Bäume, Gauben oder Schornsteine, lassen sich technisch abfedern. Zum Einsatz kommen dann sogenannte Leistungsoptimierer oder Modul-Wechselrichter, die jedes Modul einzeln überwachen und steuern. So sinkt nicht die gesamte Leistung des Modulstrangs, wenn ein einzelnes Modul verschattet ist.
Norddächer liefern zwar grundsätzlich weniger Ertrag als Süddächer – je nach Neigungswinkel und regionaler Sonneneinstrahlung kann aber auch hier eine Anlage sinnvoll sein. Besonders bei flachen Dachneigungen oder in Kombination mit einem günstigen Stromspeicher kann sich der Eigenverbrauch trotzdem lohnen. Bei flach geneigten Norddächern besteht zudem die Möglichkeit, die Module über eine Unterkonstruktion gezielt nach Süden auszurichten. So lässt sich der Ertrag optimieren – auch wenn die Dachausrichtung auf den ersten Blick ungeeignet erscheint.
Funktionieren PV-Anlagen auch im Winter?
Ja, Photovoltaikanlagen funktionieren auch im Winter – sie benötigen Licht, nicht Wärme. Auch bei kalten Temperaturen kann eine PV-Anlage Strom erzeugen, solange Tageslicht vorhanden ist. Tatsächlich arbeiten Solarmodule bei kühlen Temperaturen oft sogar effizienter als an sehr heißen Sommertagen, da hohe Hitze den Wirkungsgrad leicht verringern kann.
Natürlich ist die Sonneneinstrahlung im Winter geringer als im Sommer, die Tage sind kürzer und die Sonne steht tiefer. Deshalb fällt der Stromertrag im Winter in der Regel niedriger aus. Auch Schnee auf den Modulen kann zeitweise die Stromproduktion unterbrechen. In vielen Fällen rutscht der Schnee jedoch bei ausreichend geneigten Dächern von selbst ab – vor allem bei Glas-Glas-Modulen mit glatter Oberfläche.
Es lässt sich also sagen, dass auch in der kalten Jahreszeit bleibt deine Anlage aktiv. Sie liefert weniger, aber zuverlässigen Strom – und trägt weiterhin dazu bei, deinen Eigenverbrauch zu decken.
Was kostet eine Kilowattstunde Solarstrom vom eigenen Dach?
Solarstrom vom eigenen Dach ist in der Regel deutlich günstiger als Strom aus dem öffentlichen Netz. Während Haushaltsstrom vom Energieversorger derzeit oft 35 bis 40 Cent pro Kilowattstunde (kWh) kostet, liegen die Stromgestehungskosten einer privaten Photovoltaikanlage meist deutlich darunter.
Die tatsächlichen Kosten pro selbst erzeugter Kilowattstunde hängen von mehreren Faktoren ab: den Investitionskosten für die PV-Anlage (inkl. Montage, Wechselrichter und Speicher), den laufenden Betriebskosten (z. B. Wartung, Versicherung) und der erwarteten Lebensdauer der Anlage. Auf die gesamte Nutzungsdauer von 25 bis 30 Jahren umgerechnet, ergibt sich häufig ein Preis von rund 8 bis 12 Cent pro Kilowattstunde für den selbst erzeugten Solarstrom. Mit sinkenden Anlagenpreisen und Förderungen kann dieser Wert noch niedriger ausfallen.
Wichtig: Wer einen Batteriespeicher nutzt, muss dessen Kosten ebenfalls berücksichtigen. Der gespeicherte Strom ist deshalb etwas teurer als der direkt genutzte Solarstrom, bleibt aber im Vergleich zum Netzstrom meist wirtschaftlich.
Solarstrom vom eigenen Dach ist langfristig sehr günstig und macht unabhängiger von steigenden Strompreisen. Für eine genaue Berechnung der individuellen Kosten beraten wir gerne – einfach Kontakt aufnehmen.
Wie viel Strom produziert eine Nord-, Süd- und Ost-West-Dachseite?
Die Ausrichtung der Photovoltaikanlage auf dem Dach hat einen großen Einfluss auf die Stromerträge. Am effektivsten ist in der Regel eine Südausrichtung, da hier die Module den Großteil des Tages direktes Sonnenlicht erhalten.
- Südseite: Erzeugt ungefähr 100 % des maximal möglichen Stroms.
- Ost- oder Westseite: Liegt meist bei etwa 70 bis 85 % der Erträge im Vergleich zur Südausrichtung. Morgens oder abends trifft hier die Sonne, aber nicht den ganzen Tag über.
- Nordseite: Produziert am wenigsten Strom, meist nur 30 bis 50 % im Vergleich zur Südseite. Die Einstrahlung ist hier deutlich schwächer, was die Erträge stark reduziert.
Neben der Ausrichtung beeinflussen auch die Dachneigung, Verschattung und das Wetter den tatsächlichen Ertrag. Ideal sind Süddächer mit einem Neigungswinkel von etwa 30 bis 35 Grad.
Wer keine optimale Südausrichtung hat, kann mit einer Ost-West-Ausrichtung dennoch gute Erträge erzielen, da so die Stromproduktion über den Tag verteilt wird. Für Norddächer ist eine PV-Anlage meist nur in Ausnahmefällen sinnvoll.
Warum sollte man auf erneuerbare Energien umsteigen?
Der Umstieg auf erneuerbare Energien bietet viele Vorteile, nicht nur für die Umwelt, sondern auch für den einzelnen Verbraucher.
Fangen wir zunächst bei der Klimaerhaltung an. Durch die Nutzung von erneuerbaren Energien wird das Klima auf Dauer geschützt, da keine zusätzliche Belastung durch die Verbrennung von fossilen Brennstoffen entsteht. Auch die Treibhausgase können so weit reduziert werden, was schließlich zu einer Verbesserung unserer Lebensqualität beitragen kann.
Darüber hinaus können erneuerbare Energiequellen auch dazu beitragen, den Strompreis langfristig stabil zu halten und so Haushalten und Unternehmen finanziell entgegenkommen. Es ist also offensichtlich, warum es sich lohnt, in diese Art der Energieversorgung zu investieren und somit einen wirklichen Beitrag für die Zukunftsorientierung unseres Planeten leisten zu können.
Was spricht für eine Photovoltaikanlage?
Solarstrom ist klima- und umweltschonend. Solarstrom-Anlagen erzeugen emissionsfreien Strom. Weder Treibhausgase, Lärm noch Feinstäube werden dabei freigesetzt. Die Energie, die zur Herstellung einer Solarstrom-Anlage aufgebracht wird, wird über die Nutzungsdauer um ein Mehrfaches überkompensiert.
Photovoltaikanlagen sind eine umweltfreundliche und kostengünstige Möglichkeit, Strom zu erzeugen. Sie sind emissionsfrei, verursachen weder Lärm noch Feinstaub und benötigen kein Öl oder Gas. Da Solarstrom selbst aus Sonnenenergie gewonnen wird, ist er somit für den Planeten langfristig unbedenklich und schont das Klima.
Darüber hinaus ist die Investition in eine Photovoltaikanlage sehr lohnenswert, da sie über die Nutzungsdauer ein Mehrfaches an Energie zurückliefert, als für ihren Aufbau aufgebracht wurde. Zudem ist eine Photovoltaikanlage wartungsarm, da es nach der Installation keiner weiteren Pflege bedarf – abgesehen von jährlicher Reinigung des Moduls. All dies trägt dazu bei, dass sich die Anschaffungskosten im Laufe der Jahre amortisiert haben und rechnet sich so auch finanziell für Verbraucher.
Wie wirkt sich eine PV-Anlage auf meine Gebäudeversicherung aus?
Sobald du eine Photovoltaikanlage auf deinem Dach installierst, verändert sich auch der Wert und die Nutzung deines Gebäudes – und damit kann sich die Gebäudeversicherung anpassen oder erweitern müssen. Wichtig ist: Eine PV-Anlage gilt in der Regel als fester Gebäudebestandteil, sobald sie auf dem Dach montiert ist. Damit fällt sie grundsätzlich unter den Schutz der Wohngebäudeversicherung – aber nur, wenn du sie auch explizit anmeldest.
Meldest du deine Anlage nicht, riskierst du im Schadenfall, dass Kosten für Reparatur oder Ersatz der PV-Anlage nicht übernommen werden. Daher solltest du deine Versicherung rechtzeitig informieren – idealerweise schon vor der Inbetriebnahme. Viele Versicherer passen den Versicherungsschutz dann entsprechend an und erweitern die Police um Schäden an oder durch die PV-Anlage, z. B. durch: Sturm, Hagel, Feuer, Überspannung durch Blitzschlag, Leitungswasser- oder Frostschäden, Folgeschäden durch technische Defekte.
In manchen Fällen ist es sinnvoll, zusätzlich eine spezielle Photovoltaikversicherung abzuschließen. Diese deckt auch Risiken ab, die über die klassische Wohngebäudeversicherung hinausgehen – etwa Ertragsausfälle bei Betriebsunterbrechung, Vandalismus, Tierbisse (z. B. durch Marder) oder Diebstahl einzelner Komponenten. Auch der Wechselrichter oder Batteriespeicher kann hier mitversichert werden.
Fazit:
Eine PV-Anlage erhöht den Wert deines Gebäudes und sollte deshalb unbedingt in deiner Gebäudeversicherung berücksichtigt werden. Ein kurzes Gespräch mit deiner Versicherung genügt oft schon, um den passenden Schutz sicherzustellen – so bist du im Ernstfall auf der sicheren Seite und vermeidest unangenehme Überraschungen.
Lohnt sich ein Balkonkraftwerk?
Was ist ein Balkonkraftwerk?
Ein Balkonkraftwerk, auch Mini-Solaranlage oder Plug & Play-Solaranlage genannt, ist eine kleine Photovoltaikanlage, die in der Regel aus 1-2 Solarmodulen und einem Wechselrichter besteht. Sie wird z. B. auf dem Balkon, der Terrasse oder an der Hauswand montiert und direkt an die Steckdose angeschlossen.
Welche Vorteile hat ein Balkonkraftwerk?
- Einfache Installation: Kein großer Installationsaufwand, oft selbst montierbar.
- Direkte Stromersparnis: Der erzeugte Strom wird direkt im Haushalt verbraucht – so senken Sie Ihre Stromrechnung.
- Kostengünstiger Einstieg: Bereits ab ca. 400–1.000 € Anschaffungskosten möglich.
- Beitrag zum Klimaschutz: Sie produzieren sauberen, erneuerbaren Strom und reduzieren Ihren CO₂-Fußabdruck.
- Unabhängigkeit: Reduzieren Sie Ihre Abhängigkeit vom Stromversorger.
Wie viel kann ich sparen?
Je nach Standort und Ausrichtung können 1-2 Module etwa 200–600 kWh Strom pro Jahr erzeugen. Das entspricht einer jährlichen Ersparnis von ca. 50–150 €, je nach Strompreis und Eigenverbrauch.
Wann lohnt sich ein Balkonkraftwerk besonders?
- Wenn Sie tagsüber Strom verbrauchen (z. B. Homeoffice, Küchengeräte, WLAN-Router).
- Bei günstiger Ausrichtung nach Süden oder Westen.
- Wenn keine größeren baulichen Veränderungen möglich oder gewünscht sind (z. B. in Mietwohnungen).
Gibt es Nachteile?
- Relativ geringe Stromerzeugung im Vergleich zu einer großen PV-Anlage.
- Wirtschaftlicher Vorteil macht sich oft erst nach einigen Jahren bezahlt.
- Anmeldung beim Netzbetreiber und im Marktstammdatenregister notwendig (aber unkompliziert).
Fazit:
Ein Balkonkraftwerk lohnt sich für viele Haushalte, die unkompliziert Stromkosten senken und einen Beitrag zur Energiewende leisten wollen. Es ist besonders sinnvoll, wenn tagsüber regelmäßig Strom verbraucht wird. Wer jedoch den Stromverbrauch des gesamten Haushalts deutlich reduzieren möchte, für den lohnt sich in der Regel eine größere Photovoltaikanlage auf dem Dach, da sie wesentlich mehr Strom erzeugen kann.
Wer darf eine PV-Anlage planen und installieren?
Die Planung und Installation einer Photovoltaikanlage sollte von qualifizierten Fachleuten durchgeführt werden. Das sind in der Regel Elektroinstallateure, spezialisierte Solarteure oder Fachbetriebe für Photovoltaik. Diese Experten verfügen über das nötige Wissen zu elektrischen Anlagen, Sicherheitsvorschriften und den spezifischen Anforderungen von PV-Systemen. So wird sichergestellt, dass die Anlage fachgerecht, sicher und effizient installiert wird.
Wichtig: Die elektrische Installation muss den gültigen Normen und Vorschriften entsprechen (z. B. VDE-AR-N 4105 in Deutschland) und von einem zugelassenen Fachbetrieb ausgeführt werden. Für den Anschluss an das öffentliche Stromnetz ist zudem meist eine Anmeldung beim Netzbetreiber erforderlich.
Selbstmontage ist technisch möglich, wird aber aus Sicherheits- und Haftungsgründen in der Regel nicht empfohlen.
Bei Cellix Energy kommt alles aus einer Hand: Qualifizierte Planer und erfahrene Dachdecker arbeiten eng zusammen, um eine reibungslose und professionelle Umsetzung der PV-Anlage sicherzustellen.
Was muss ich als Mieter oder Vermieter bei PV-Anlagen beachten?
- Rechte und Pflichten des Vermieters
Vermieter, die eine Photovoltaikanlage auf dem Dach ihres Gebäudes installieren möchten, sollten die baulichen Voraussetzungen und rechtlichen Rahmenbedingungen prüfen. Dazu gehören Genehmigungen, bauliche Änderungen am Gebäude und die Abstimmung mit dem Mietvertrag. Der Vermieter kann die Anlage entweder selbst betreiben oder einem Dienstleister überlassen. - Zustimmung des Mieters
Wenn die Installation die Mietwohnung oder gemeinschaftliche Flächen betrifft (z. B. Dachnutzung, Zuleitungen im Gebäude), kann die Zustimmung der Mieter erforderlich sein. Zudem ist es wichtig, klar zu regeln, wie der selbst erzeugte Strom genutzt wird – zum Beispiel ob Mieter davon profitieren oder ob er ausschließlich für den Vermieter vorgesehen ist. - Stromversorgung und Abrechnung
Bei Anlagen auf Mehrfamilienhäusern kann der erzeugte Solarstrom direkt im Gebäude verbraucht werden (Eigenverbrauch). Für die Verteilung und Abrechnung zwischen Vermieter und Mietern gelten bestimmte gesetzliche Vorgaben, beispielsweise bei der Nutzung von Mieterstrommodellen. - Fördermöglichkeiten und steuerliche Aspekte
Sowohl Vermieter als auch Mieter sollten sich über Förderprogramme und steuerliche Vorteile informieren. Für Vermieter gibt es spezielle Regelungen zur Abschreibung und Einspeisevergütung. Mieter können unter Umständen vom günstigeren Stromtarif durch Mieterstrom profitieren. - Verantwortung und Wartung
Der Vermieter trägt meist die Verantwortung für Wartung und Instandhaltung der PV-Anlage. Es empfiehlt sich, klare Vereinbarungen zu treffen, damit alle Beteiligten wissen, wer für welche Aufgaben zuständig ist.
Muss ich meine PV-Anlage bei der Bundesnetzagentur melden?
Ja, jede netzgekoppelte Photovoltaikanlage muss beim Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur registriert werden. Diese Registrierung ist gesetzlich vorgeschrieben und wichtig, um unter anderem die Einspeisevergütung zu erhalten.
Die Anmeldung muss in der Regel innerhalb eines Monats nach Inbetriebnahme erfolgen und kann online durchgeführt werden. Zudem ist oft eine Anmeldung beim örtlichen Netzbetreiber notwendig.
Wie unterstützt Cellix Energy?
Bei Cellix Energy übernehmen wir die komplette Anmeldung Ihrer PV-Anlage – vom Marktstammdatenregister bis zur Netzbetreiber-Meldung. So sind Sie rechtlich auf der sicheren Seite und können sich auf eine reibungslose Abwicklung verlassen.
Wie lange dauert die Installation meiner PV-Anlage – vom ersten Kontakt bis zur Inbetriebnahme?
Die Dauer einer Photovoltaik-Installation hängt von mehreren Faktoren ab, insbesondere von der Entscheidungszeit und der Verfügbarkeit aller Beteiligten. Bei Cellix Energy lässt sich der Ablauf typischerweise so zusammenfassen:
- Nach der Entscheidung für eine PV-Anlage vergehen meist maximal 6 bis 8 Wochen, bis die Montage auf dem Dach erfolgt.
- Nach der Montage folgt die elektrische Installation und der Anschluss der Komponenten durch unseren Elektromeister. Das dauert in der Regel weitere 1 bis 2 Wochen.
- Anschließend erfolgt die Anmeldung der Anlage bei den zuständigen Stellen und die endgültige Inbetriebnahme.
Insgesamt kann man von etwa 8 bis 12 Wochen vom ersten Kontakt bis zur funktionierenden Anlage ausgehen – abhängig von individuellen Rahmenbedingungen und Genehmigungsverfahren. Bei Cellix Energy begleiten wir Sie Schritt für Schritt, damit der Prozess so reibungslos und zügig wie möglich verläuft.
Ist eine PV-Anlage auch auf Flachdächern oder Carports möglich?
Ja, Photovoltaikanlagen lassen sich sehr gut auf Flachdächern und Carports installieren. Gerade Flachdächer bieten sogar besondere Vorteile:
- Keine Bohrungen oder zusätzliche Belastungen: Mit speziellen Montagesystemen von Cellix Energy können Module ohne Bohren befestigt werden. Das schützt die Dachhaut und vermeidet zusätzliche Lasten.
- Flexible Ausrichtung: Die Module werden in optimalem Winkel aufgeständert, um bestmöglichen Ertrag zu erzielen – unabhängig von der eigentlichen Dachneigung.
- Schnelle und schonende Montage: Dank der innovativen Montagesysteme ist die Installation auf Flachdächern besonders unkompliziert und schonend für die Bausubstanz.
Auch Carports eignen sich hervorragend für PV-Anlagen, da sie oft eine freie, unverschattete Fläche bieten und die erzeugte Energie direkt vor Ort genutzt werden kann.
Wie läuft die Abrechnung – Einspeisung, Eigenverbrauch, Net-Metering oder Einspeisevergütung?
Bei einer Photovoltaikanlage gibt es verschiedene Möglichkeiten, den erzeugten Strom zu nutzen und abzurechnen:
Eigenverbrauch: Der selbst erzeugte Strom wird direkt im Haushalt oder Betrieb verbraucht. Das spart Kosten für den Bezug von Netzstrom und ist wirtschaftlich oft am attraktivsten.
Einspeisung: Überschüssiger Strom, der nicht selbst verbraucht wird, wird automatisch ins öffentliche Netz eingespeist. Dafür erhält der Betreiber eine Einspeisevergütung vom Netzbetreiber, die gesetzlich geregelt ist.
Net-Metering: Dieses Modell, bei dem eingespeister und bezogener Strom gegeneinander verrechnet werden, ist in Deutschland noch nicht flächendeckend üblich.
Einspeisevergütung: Die Vergütung für eingespeisten Solarstrom wird meist über einen festen Zeitraum (z. B. 20 Jahre) garantiert und richtet sich nach Anlagengröße und Zeitpunkt der Inbetriebnahme.
Muss man sich selbst um die Abrechnung kümmern?
In den meisten Fällen läuft die Abrechnung automatisch. Die Anlage misst selbst den Eigenverbrauch und die Einspeisung über Zähler, die vom Netzbetreiber oder Messstellenbetreiber installiert werden. Die Auszahlung der Einspeisevergütung erfolgt direkt an den Betreiber. Trotzdem ist es wichtig, die Zählerstände regelmäßig zu überprüfen und die Anlage bei den zuständigen Stellen anzumelden.
Wie viel CO₂ spare ich ein und wie umweltfreundlich ist Photovoltaik?
Photovoltaikanlagen tragen erheblich zur Reduzierung von CO₂-Emissionen bei, da sie sauberen, erneuerbaren Strom erzeugen – ganz ohne Verbrennung fossiler Brennstoffe. Im Vergleich zur Stromerzeugung aus Kohle oder Gas können PV-Anlagen pro Kilowattstunde erzeugtem Strom mehrere hundert Gramm CO₂ einsparen.
Die genaue Einsparung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Anlagengröße, dem Standort und dem lokalen Strommix. Durchschnittlich spart eine 1 kWp-Anlage in Deutschland jährlich etwa 500 bis 800 kg CO₂ ein.
Auch die Umweltfreundlichkeit der PV-Technologie hat sich in den letzten Jahren stark verbessert: Die Herstellung von Solarmodulen ist effizienter geworden, der Materialeinsatz optimiert, und Recyclingprogramme sorgen dafür, dass viele Komponenten am Lebensende wiederverwertet werden.
Insgesamt gilt Photovoltaik als eine der nachhaltigsten und umweltfreundlichsten Technologien zur Stromerzeugung, die einen wichtigen Beitrag zur Energiewende und zum Klimaschutz leistet.
https://www.ibc-solar.de/rechner-und-kalkulatoren/wirtschaftlichkeitsrechner-pv-anlagen/